(Persönliche) Gedanken zu Fashion For Future 2025

© Emily Whitney for FFF
Ein wenig Zeit ist schon vergangen, wir haben wieder Kräfte gesammelt. Von 11. bis 16. April 2025 hat unser Festival für einige Bewegung in der Stadt gesorgt, FFF 25 war bereits die 3. Edition. Unterschiedliche Perspektiven auf die Textil- und Modeindustrie sollten es sein und sind es auch geworden. Eine Mischung aus Information, Inspiration und Hands-on-Workshops. Wirklich erfreulich war, wieviel Presse-Echo es gab (danke Maria Lobis für die Unterstützung), wie es gelungen ist, vor allem junge Leute zu involvieren. Das spannende an unserem Team – Aart van Bezooijen/UniBz, Brigitte Gritsch/Netzwerk Südtiroler Weltläden, Verena Dariz/OEW und ich – ist, dass wir nicht nur unterschiedliche Backgrounds haben, sondern auch unterschiedliche Erfahrungen und Expertisen in den Bereichen Materialien/Mode/bewusster Konsum/Fairtrade einbringen. Das ist eine gute Basis für vielfältige Angebote und Zugänge. Dass die Textil- und Modeindustrie mit ihren hochkomplexen globalen Lieferketten großen Veränderungsbedarf hat, muss ich hier vermutlich nicht wiederholen.
ABER: Wie sie besser, nachhaltiger und fairer machen? Wie verständlich machen, dass es auch an uns liegt, hier Veränderungen voranzubringen? Das ist immer wieder eine Herausforderung, die mal gut, mal weniger gut gelingt. Diese Fragen haben mich nach unserer Veranstaltung intensiv beschäftigt.



Sehr berührt hat mich die Ausstellung „handmade“, die der niederländische Zweig der Clean Clothes Campaign Schone Kleren zusammengestellt hat und auf Wanderschaft schickt. Da ließ sich ganz direkt hineinblicken in die wenig erfreuliche textile Produktionswelt. Der Großteil dessen, was wir tragen, wird in sogenannten Low-Income-Ländern produziert, wo es kaum Regelungen gibt, weder was die Arbeitsbedingungen, noch was Umweltauflagen betrifft. Mit den entsprechenden Auswirkungen auf die Arbeiter*innen in Asien, Afrika, Südamerika, aber auch in Ost- und Südeuropa.
„WAS würden wir Kleiderkonsument*innen in Europa dazu sagen, wenn wir so arbeiten müssten?“, habe ich mich gefragt. Wo ein Arbeitstag bis zu 16 Stunden haben kann? Ohne soziale Absicherung, ohne Bezahlung eines Lohnes, von dem man zumindest bescheiden leben kann?
Unsere Kleidung wird zu 80 % von Frauen hergestellt. Je besser die Jobs, desto mehr Männer gibt’s. Einige dieser Frauen kommen in der Ausstellung zu Wort, sprechen über ihre Arbeit, die Sicherheitsrisiken, den geringen Lohn, die Belästigungen und Belastungen und auch darüber, was sie bräuchten. Ich erinnere mich an die Aussage einer Arbeiterin: „Sie verlangen Perfektion von uns, aber weder die Fabriksbesitzer noch die Auftraggeber sind bereit, uns anständig zu bezahlen und zu behandeln. Wir sind ihnen egal.“

Neben der Ausstellung „handmade“ gab es am Rathausplatz eine Installation, die textile Lieferketten sichtbar und begehbar machte, gemeinsam mit Ahoi wurde ausgiebig geswapt, einen ganz besonderen Swap haben Eco-Social-Design-Student*innen im Waag Café organisiert, ich habe zwei Slow Fashion Walk & Talk Touren durch die Stadt gemacht, wo wir lokale Player (Kleopatra, Weltladen, Artelier, Kauri Store und Violeta Nevenova) besuchten.
Die deutsche Ökonomin und Aktivistin Lavinia Muth hat sich in ihrem Workshop „Unraveling Coloniality in Fashion Supply Chains“ unseren immer noch verankerten kolonialen Denkstrukturen in den textilen Lieferketten gewidmet, später dann war sie im Gespräch mit Designer und Fashion Revolution Coordinator Uganda Godfrey Katende.
Es gab einen Upcycling-Workshop unter Verwendung lokaler Textilabfälle, zwei Store-Gespräche: mit der (Slow) Fashion Designerin Dagmar Gruber über ihr Label „Dama“ und mit der Vintage-Expertin Eva van Gelder über den besseren Umgang mit Denim, zu hören war eine Fallstudie über die Praktiken des chinesischen Ultra-Fast Fashion Giganten SHEIN, die Co-Gründerin des Textillabors Lottozero Arianna Moroder hat über ihre Arbeit und textile Innovationen gesprochen und Model, Coach und Future Fashion Aktivistin Martina Gleissenebner-Teskey präsentierte ihr Projekt walk4future, das gesunde Bewegung und bewussten Modekonsum verbindet. Die Challenge startet übrigens am 1. Mai. Ihr seid herzlich eingeladen mitzumachen, ich habe mich bereits angemeldet.

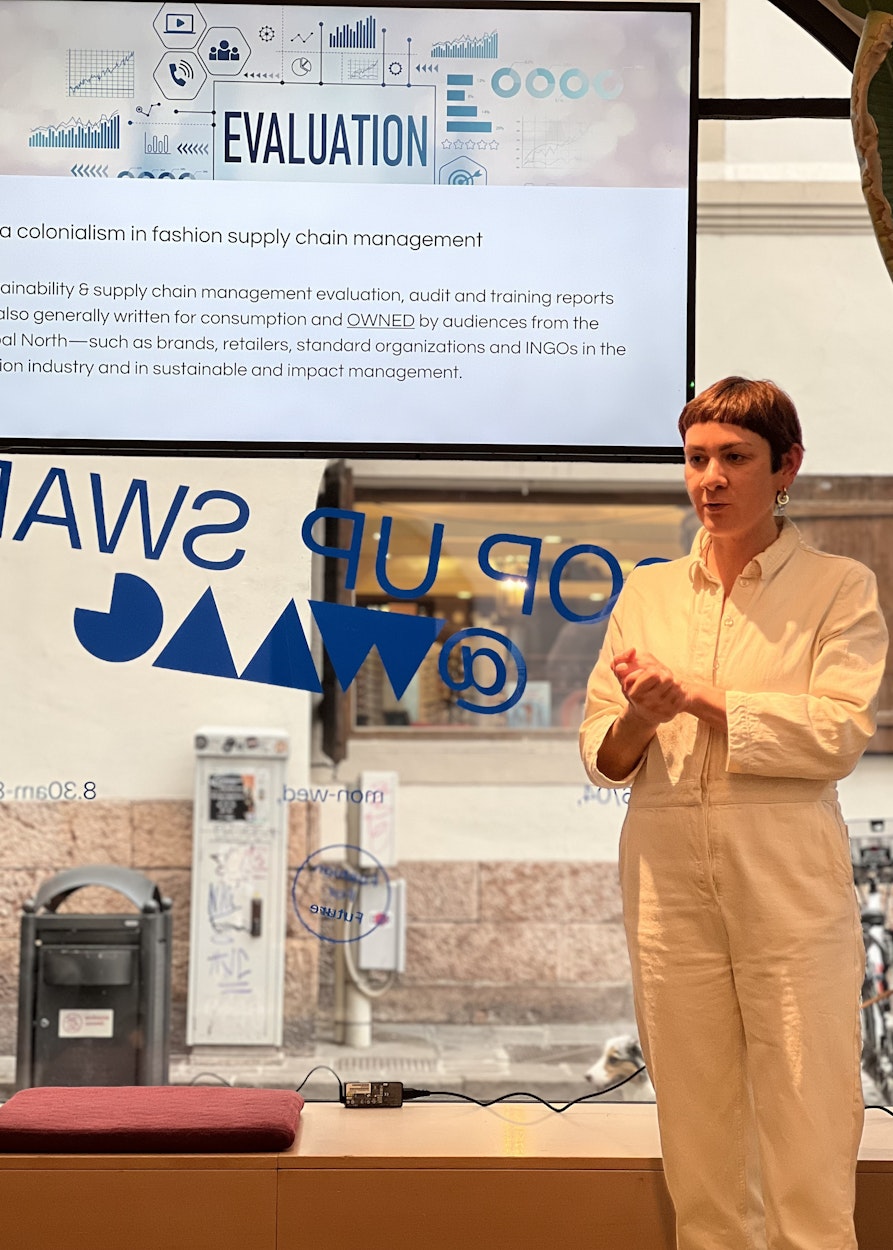

VIEL haben wir in den Festivaltagen auch darüber gesprochen, wie eine Kommunikation unserer Themen aussehen muss, dass sie wirklich nachhaltig wirkt und viele Leute erreicht. Überraschend war zum Beispiel, dass ein großer Teil der Slow Fashion Community nicht gekommen ist zu den Veranstaltungen. Dafür aber andere. Lässt sich daraus etwas schließen? Ich weiß es (noch) nicht. Aber mehr denn je geht es mir darum, zu verstehen, wie wir Leute erreichen können. Einfach müsse der Zugang sein, nicht zu aufwendig und möglichst angenehm. Das bekomme ich immer wieder als Rückmeldung. Ich kann das gut nachvollziehen, aber wie genau die Mischung zwischen Leichtigkeit und dann doch harter Realität im Detail aussehen muss, das ist mir noch nicht so klar. Ein Ansatzpunkt könnte jedoch die Ausstellung sein, von der ich gerade sprach. Kurze Videos, die eindringlich und eindrücklich sind, die die Realität der Textil*arbeiterinnen zeigen, die den Blick hinter die Kulissen erlauben ohne zu verschrecken. Die aber berühren und nachdenklich machen. Dazu kurze prägnante Insights in die Modeindustrie, wie sie arbeitet, wer dabei verdient und wer nicht.

Um mehr Aufmerksamkeit für das Thema zu bekommen, braucht es die aktive Teilnahme der lokalen Community. Der Labels, Brands, Geschäfte und Akteur*innen, derjenigen, die auf ihre jeweilige Art und Weise versuchen, etwas besser zu machen. Sie sind die Multiplikatoren. Das ist heuer soso gelaufen. Nächstes Jahr wird es besser gelingen. Denn ich bin überzeugt davon, dass wir nur gemeinsam weiterkommen. In diesem Sinne: Help us to spread the Message.

Zu einzelnen Gästen/Themen könnt ihr mehr erfahren: